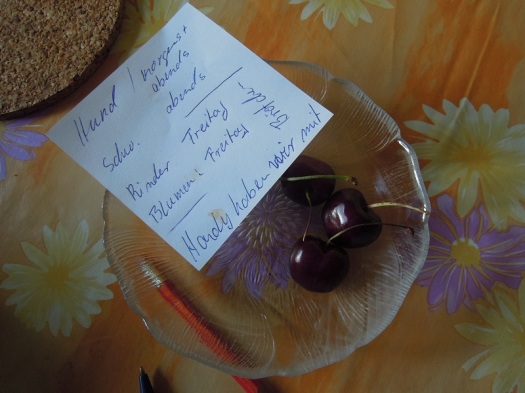Auszug aus einem Drama, das ich zurzeit schreibe.
Ungefähre Themen: Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine, Diskrepanzen der Selbstwahrnehmung, Autos und Alkohol.
__________________________________
Szene 1
Adrian ist schwer verwundet, Blut, Prellungen. Er steht am Rande der Bühne. Um ihn herum weißes Rauschen als Ton. Auf der Bühne Schwarz.
Adrian: langsam, bedächtig
Große. Große grüne. Große grüne Bäume. Große grüne Bäume… am Rand. Am Rand der. Große grüne Bäume am Rand der… am Rand der Straße. Große grüne Bäume am Rand der Straße mit. Mit verzweigtem Geäst. Große grüne Bäume am Rand der Straße mit verzweigtem Geäst. Mit festen. Große grüne Bäume am Rand der Straße mit verzweigtem Geäst, mit festen Wurzeln und einem schweren, harten. Große grüne Bäume am Rand der Straße mit verzweigtem Geäst, mit festen Wurzeln und einem schweren, harten Stamm. Vögel zwitschern. Der Sommer naht. Große, grüne Bäume am Rand der Straße mit verzweigtem Geäst, mit festen Wurzeln und einem schweren harten Stamm. Vögel zwitschern. Der Sommer naht.
Ein starker Wind, ein leichtes Rauschen im Laub. Vollkommen unerfahren. Erfahren, erfährt, er fährt. Er fährt die Karre. Ist schon kein Problem.
Vor den Bäumen ein Graben. Gras, lange Halme, Regenwasser in der Mulde. Vielleicht ein Frosch, der sich verirrt hat. Frösche verirren sich oft. Die verirren sich scheiße-oft! Ich hab mich ja noch nie gut orientieren können, aber Frösche… ohne Witz.
Vor dem Graben eine Straße. Aus Asphalt, Teer. Beton, Pflaster, Schotter, Kopfsteine. Kopf auf Stein. Erstens: die Fahrbahn, unterteilt in Fahrstreifen und Randstreifen. Zweitens: Trennstreifen, unterteilt in Mittelstreifen und Seitentrennstreifen. Drittens: Standstreifen. Viertens: Parkflächen. Fünftens: das Bankett, die Reflektoren. Sechstens: Geh- und Radwege. Siebtens: Borde und Entwässerungsrinnen.
Hinter den Bäumen ein Feld – mit Mais. Der Mais ging bis zu den Knien. Wenn man allzu schnell durch das Feld lief, schnitt man sich an den scharfen Blättern die Haut auf. Schaut mich an – meine Wunden, meine Kratzer. Sie entstammen keinem Maisfeld. Wer seine Wunden zeigt, wird geheilt. Wer nicht, der nicht.
Hinter dem Feld ein Wald mit großen, grünen Bäumen und ihrem verzweigtem Geäst, festen Wurzeln und ihren schweren, harten Stämmen. In ihren Zweigen flüstert der Wind und kreischen, brüllen, jaulen und stöhnen die Vögel. Du Elendiger, flüstert der Wind. Stirb, kreischen die Vögel. Doch ich bin viel zu müde, ihnen zuzuhören. Ich höre kaum noch zu, ich höre eh nichts mehr. Warum noch zuhören, wenn man nichts versteht.

Am Ende dann ein Lachen. Und ein Luftholen vom ganzen Lachen. Und ein Schreien neben mir. RECHTS, hat sie geschrien. Dann NEIN, langgezogen. Ungefähr so: NEI-EI-II-N. Betonung auf dem I. Sie hat danach nichts mehr geschrien, sie war dann weg, weit hinten irgendwo verloren in ihrem Kopf. Ich war verschwunden. Der Körper lag noch da auf den Fellbezügen im Auto meiner Großmutter. Der Körper war da, die Hülle, mehr schlecht als recht. Aber hey, immerhin vorhanden.
Nur ich war irgendwie weg.
Dann hat keiner etwas gesagt… Anfangs.
Auf der Bühne wird es langsam und allmählich heller. Man sieht ein Auto auf der Bühne. Ein paar Bäume. Ein rustikaler Holztisch, weiter vorne. Das weiße Rauschen schwindet.
Später wurde dann sehr viel gesagt. Die Zeitung kam, das Radio, sogar das Fernsehen hatte sich angemeldet. Es kam dann noch eine größere Meldung, ein paar Kreise weiter. Sie haben sich dann dafür entschieden. Finde ich auch richtig, man muss Prioritäten setzen, gerade im heiß umtobten Mediengeschäft. Da muss man Bilder liefern, Erwartungen erfüllen, Horizonte befriedigen. Der Landwirt neben an wurde befragt, vom Radio. Von einem Radioreporter. Nicht vom Radio selbst.
Es sei gar nicht laut gewesen, das habe ihn selber überrascht. Sein Sohn sei morgens zur Arbeit gefahren, der habe uns dann auf dem Feld liegen gesehen. Uns – mich, sie und –
das Auto.
Szene 2
Aus dem Auto steigt eine junge, attraktive Frau im Partyoutfit und setzt sich lasziv auf die Motorhaube. Adrian geht von der Bühne.
Mädchen: schrill, laut, schnell
Das Auto!
Das Auto! Das Auto! Das Auto!
Ich sitze auf der Motorhaube, auf dem Motor. Das ist das Herz des Autos, das zentrale Nervensystem. Hier wird aus Dreck Leistung, aus Sprit wird Schnelligkeit, aus Metall und Leder Statussymbol. Und falls es nicht laufen sollte – wer sein Auto liebt, der… na, kann man sich ja wohl denken. Auf jeden Fall finde ich es unsagbar wichtig, zu betonen, auch auf eine ganz neutrale, wenig konsumorientierte Weise, dass ein Auto auch bloß eine Maschine ist. Das finde ich ungeheuer wichtig, sich das mal ganz privat und ernst klarzumachen im Kopf.
Das Auto ist bloß eine Maschine. Das ist im Grunde eine verlängerte Extremität unserer Beine, zur Fortbewegung. Von Punkt A zu Punkt… zu Punkt C. Punkt B haben wir schon weit hinter uns zurückgelassen, so gut geht es uns heutzutage. B ist Anfängerkram. Von null auf Punkt B in zweikommadrei Sekunden und die Zahl sinkt rasant. Schon in wenigen Jahren werden es einskommadrei Sekunden sein! Einskommaeins. Nullkommaneun. Nullkommasechs. Nullkommadrei. Nullkommanull. Null! Oder Minus Zweikommadrei Sekunden! Dann werden wir schon Tempo 100 fahren, obwohl wir noch in der Garage stehen.

Das Auto ist bloß eine Maschine, ich mein, ernsthaft jetzt. Ohne Spaß. Das mit der Werbung und so, klar, das sieht schön aus, das hat ordentlich Wumms, ordentlich Karacho. Aber Werbung ist Werbung. Krieg ist Krieg und Schnaps ist Schnaps. Auto ist Auto und Schnaps ist Schnaps. Deshalb haben wir ja auch so viel dagegen, wenn wir unter Schnapseinfluss Auto fahren. Denn das Auto ist bloß eine Maschine. Ohne eigenen Willen. Dafür darf es sich auch den Willen des Menschen borgen und das ist Wille genug. Mehr Wille, als dem Auto lieb ist. Auto ist die Kurzform von „Automobil“ und das heißt „bewegt sich von selbst“, „selbstbeweglich“. Doch all diese Beweglichkeit wäre ohne unseren freien Willen bedeutungslos. Und wenn wir betrunken fahren, dann fahren wir mit einem mehr als ausufernden Willen. Betrunken war ich ziemlich oft, you know, ich kenn mich da schon ein bisschen aus.
Ihr könnt mir da ruhig glauben. Ich mein, bloß weil ich ein Mädchen bin. Okay, I like to party. Okay. Geb ich zu. Ist ja heutzutage so, als ob das eine Sünde wär, das Feiern.
Es steigt ein weiteres Mädel im Partyoutfit aus dem Auto und räkelt sich am Kofferraum.
Mädchen 2: ebenfalls schrill, laut, aufdringlich
Feiern! Yeah! Feiern, Feten, Partys.
Ich weiß genug, ich weiß Bescheid, ich war dabei. Das tolle am Feiern ist der Eskapismus. Eskapismus vom Alltag. Das Entschwinden im Moment, wo das Stroboskop nicht flimmert. Wo alles schwarz ist. Da lebt es sich gut und bequem. In den schwarzen Momenten des Stroboskopflimmerns. Epileptiker können diesen Moment nicht teilen, die ertragen keine Stroboskope, aber hey! Epileptiker haben auch allenfalls bloß ein halbes Leben.
Mädchen 1:
Ey! Zweidrittelleben.
Mädchen 2:
Okay, haste Recht! Zweidrittelleben. Das wär ja sonst ein bisschen fies den Epileptikern gegenüber. Die wollen ja auch bloß Spaß haben oder süße Leute küssen.
Partys. Das Schöne an Feten ist nicht zwangsläufig der Alkohol. Ich kann voll gut ohne diese Alltagsdroge überleben, das habe ich mir oft genug bewiesen. Tagelang keinen Tropfen, nächtelang total abstinent, sauber, clean. Mit leerer Nase und kleinen Pupillen durch die heißesten Clubs des Kreises – und lasst euch was gesagt sein: es mag hier auf dem Land nicht viele Clubs geben, aber die, die es gibt – das sind die Heißesten! Da trifft sich, was Rang und Namen hat. Und ich habe Rang, ich habe Namen, ich habe Geld. Ich habe vor allem auch the looks, wie der Brite sagt.
Ist nicht so, dass the looks zwangsläufig entscheidend sind. Ich gehe auf keine Partys wegen der Jungs. Ich gehe auf Partys auf keine Jungs zu.
Da kommen die Jungs auf mich zu, ganz gerne, obwohl ich kein Interesse habe. Oder vielleicht, WEIL ich kein Interesse habe. Das macht sie scharf, das macht sie geil und willig. Man will ja auch erobert werden. Und da kommen sie auf einen zu und flüstern einem Dinge ins Ohr. „Ich habe so Lust auf dich.“ Oder: „Im Bett bin ich eine Maschine!“
Mädchen 1:
Ein Mensch ist ein Mensch, auch wenn er gerne sagt, er sei eine Maschine. Doch, wenn man ein Auto in ein Bett legen würde, wäre es immer noch eine Maschine. Wir Menschen neigen dazu, uns Menschen zu vermaschinisieren und die Maschinen werden vermenschlicht. Das ist ein Problem.
Autos sind Maschinen. Sie bewegen uns, sie geleiten uns, sie lassen uns entführen, sie –
Mädchen 2:
– sie geben uns Sicherheit. Sicherheit, die wir sonst nirgends nie haben.
Wir werden nur zu unserer eigenen Sicherheit verkabelt mit dem Sicherheitsgurt, dingfest gemacht mit den Sicherheitskopfstützen, festgezurrt mit dem Gurtstraffer, im Notfall vorgewarnt vom Airbag. Der Airbag explodiert und während man im weichen Weiß landet, denkt man sich: „Ui, das hätte schief gehen können. Aber dank Airbag, Gurtstraffer, Sicherheitskopfstütze und last but not least dem good old Sicherheitsgurt werde ich auch in Zeiten des Unfalls bestens versorgt.“

Und dann die ganzen unsichtbaren Mechanismen. Der Überrollbügel. Das Auto überschlägt sich im Dauerregen auf nasser Fahrbahn; die Frisur sitzt. Oder was wären wir denn bitte sehr ohne deformierbare Lenkräder mit ausklinkbaren Lenksäulen! Und es gibt auch immer konstruktivere Maßnahmen zum Unfallgegnerschutz. Wenn unsere Frisur schon so gut sitzen bleibt, dann wollen wir schließlich ja auch, dass unser Unfallgegner, ach! unser Unfallpartner, bestens versorgt wird. Oder zumindest nur seine Beine zerschmettert werden, nicht sein Kopf. Wir haben die Knautschzone. Energie absorbieren, Energie sparen. Und später dann die überschüssige Energie wegtanzen. Was halten wir von ASB und ESP? Hm? Wer weiß denn schon, was das bedeutet? Unsereins versteckt sich liebendgern hinter all diesen Abkürzungen, auf das sie uns Sicherheit vorgaukeln. Was heißt hier gaukeln! Geben! Sie geben uns Sicherheit, wir geben ihnen dafür unser Vertrauen. Halleluja, halleluja. Wir haben Vertrauen in sie. Doch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir haben von A bis Z also die –
Mädchen 1, Mädchen 2: gleichzeitig, maschinell aufzählend
Ablegereifen!
Active Jaw Contols!
Anbauabnahmen!
Aufpralldämpfer!
Anprallsockel!
Anti-Schleudertrauma-Sitzsysteme!
Crashsensoren!
Fahrzeugrückhaltesysteme!
Falling Object Protection Structures, kurz: eff-oh-pie-ess!
Fahrzeugbeleuchtung!
Gasanlagenprüfung!
Gurtschlitten, Gurtschloss, Gurtkraftbegrenzer!
Katzenaugen!
Kindersitze!
Konturmarkierungen!
Pedal Release Systems!
Profiltiefenmessungen!
PVC-Gurtbänder!
Reflektorfolien!
Reifendruckkontrollsysteme!
Insassenrückhaltesysteme! (Mädchen 2: Und für unsere beeinträchtigten Freunde und Freundinnen gibt es die Rollstuhlrückhaltesysteme gratis mit oben drauf!)
Rückspiegel und Rückstrahler!
Schutzplanken!
Side Impact Protection Systems, kurz ess-eih-pie-ess!
Spanngurte!
Spikes!
Supplemental Restraint Systems!
Tagfahrlicht!
Unfalldatenspeicher!
Verkehrstrennungsgebiet!
Die Zweikreisbremsanlage!
Und Vertrauen! Vertrauen haben wir auch. Wo kämen wir denn sonst hin, wenn wir nicht vertrauen würden. Vertrauen ist das Allerwichtigste. Ohne Vertrauen keine Hoffnung, ohne Hoffnung kein Fortschritt, ohne Fortschritt keine Zukunft. Vertrauen ist die Grundbasis des Menschen. Vertrauen und Gier. Doch auf Vertrauen sind wir stolz. Vertrauen ist Mechanismus zur Reduktion der Komplexität. Wir werden behütet, bewacht und begleitet von so vielen komplexen Mechanismen, dass wir Vertrauen dringend nötig haben. „Vertrauen ist gut und Treue ist Kraft.“ Stammt von Marie von Ebner-Eschenbach. Guter Spruch, finden wir gut. Wir haben so viel Vertrauen. Vertrauen in Gott. Vertrauen in eine Beziehung. Vertrauen in die Zukunft. Vertrauen in Politiker. Vertrauen in den Euro. Vertrauen in Deutschland. Vertrauen in Technologie.
Wir vertrauen in etwas hinein und holen es dort nie mehr hervor.
Mädchen 1:
Somit ist es ein Leichtes, Auto zu fahren. Man müsste es kaum noch lernen. Aber wir tun es mal lieber. Vertrauen ist ja gut, aber Kontrolle ist… na, kann man sich ja wohl denken. Auf jeden Fall finde ich es unsagbar wichtig, zu betonen, auch auf eine ganz neutrale, wenig konsumorientierte Weise, dass wir keine Sklaven sind.
Bist du ein Sklave?
Mädchen 2: erstaunt
Ich? Nein! Du denn?
Mädchen 1:
Nein, wo denkst du hin. Haha.
Wir sind keine Sklaven und keiner ist es. Kein Mensch ist ein Sklave, zumindest nicht freiwillig. Wir lassen uns nicht freiwillig von der Maschine verführen, verwünschen, versklaven. Diese Maschine kann nicht versklaven, denn Maschinen können das nicht. Nur Menschen versklaven. Alles andere wäre Science-Fiction. Maschinen haben keine Seele. Keinen Geist. Der Geist aus der Maschine existiert nicht.
Mädchen 2:
Deus ex machina. Ist’n Fake. Hat’s nie gegeben. Auch hier nicht. Hier erst recht nicht.
Mädchen 1:
Drum faltet eure Hände zum Gebet und betet mir nach: Wir akzeptieren und schätzen die technischen Möglichkeiten des Automobils und verstehen seine kulturelle Bedeutung, auch und gerade auch als Statussymbol…,
Mädchen 2: hinterher betend
Wir akzeptieren und schätzen die technischen Möglichkeiten des Automobils und verstehen seine kulturelle Bedeutung, auch und gerade auch als Statussymbol…,
Mädchen 1:
…doch gleichzeitig wissen wir um die Gefahren; wissen, dass das Auto bloß eine Maschine ist und lassen uns erst recht nicht von so einer Maschine versklaven, auch wenn es – zugegeben – schon irgendwie Charme hätte.
Mädchen 2:
…doch gleichzeitig wissen wir um die Gefahren; wissen, dass das Auto bloß eine Maschine ist und lassen uns erst recht nicht von so einer Maschine versklaven, auch wenn es – zugegeben – schon irgendwie Charme hätte.
Amen.
Mädchen 1:
Wie säh‘ das denn auch aus, bitte sehr, wenn wir uns von so eine Karre – hahaha – versklaven lassen würden!
Mädchen 2:
Haha! „Und hinter tausend Zylindern keine Welt!“
_____________________________________________
Bittebittebitte FeedbackIdeenKritikLob!!!!
shaer, shrea, shrae, share
Gefällt mir Wird geladen …